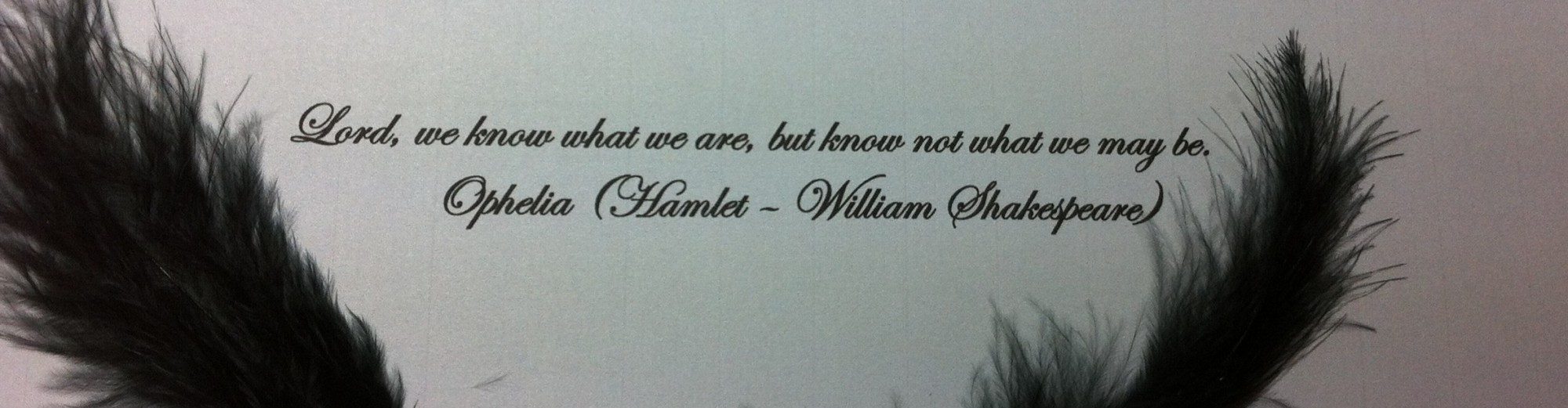An einem regnerischen Freitag im November betrat Marcus Mommsen das Haus in der Lindenstraße 22. Er stieg wie immer zu Fuß die drei Treppen bis zu seiner Dachgeschosswohnung empor. Auf dem letzten Treppenabsatz blieb Mommsen kurz stehen, um in seiner Aktentasche nach dem Haustürschlüssel zu suchen. Er fand ihn in einer Seitentasche und stutzte. Etwas war anders, und das gefiel Mommsen gar nicht. Er sah zu seiner Wohnungstür und traute seinen Augen nicht. Auf der schönen neuen Fußmatte saß ein Pinguin. Er reichte Mommsen ungefähr bis zur Hüfte und schaute ihn erwartungsvoll an.
An einem regnerischen Freitag im November betrat Marcus Mommsen das Haus in der Lindenstraße 22. Er stieg wie immer zu Fuß die drei Treppen bis zu seiner Dachgeschosswohnung empor. Auf dem letzten Treppenabsatz blieb Mommsen kurz stehen, um in seiner Aktentasche nach dem Haustürschlüssel zu suchen. Er fand ihn in einer Seitentasche und stutzte. Etwas war anders, und das gefiel Mommsen gar nicht. Er sah zu seiner Wohnungstür und traute seinen Augen nicht. Auf der schönen neuen Fußmatte saß ein Pinguin. Er reichte Mommsen ungefähr bis zur Hüfte und schaute ihn erwartungsvoll an.
„Guten Abend“, sagte der Pinguin. Mommsen glaubte, sich verhört zu haben. Hatte der Pinguin gesprochen? Vorsichtig schaute sich Mommsen um. Aber außer sich und dem Tier konnte er niemanden entdecken.
„Guten Abend“, antwortete Mommsen unsicher.
„Das wird aber auch Zeit, dass Sie nach Hause kommen. Ich warte schon seit einer Stunde auf Sie.“ Mommsen meinte, einen vorwurfsvollen Ton herauszuhören, und versuchte, ein Gefühl leichten Ärgers zu unterdrücken.
„Wollen Sie mich nicht hereinbitten?“ Der Pinguin trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
„Entschuldigung, kennen wir uns?“, Mommsen stand noch immer an der Treppe.
„Oh, wie unhöflich von mir“, gluckste der Pinguin. „Mein Name ist Bonaparte. Wir kennen uns nicht, aber Sie wurden mir empfohlen.“
„Wirklich?“ Mommsen klappte der Mund nach unten. Wer um Himmels willen würde ihn einem Pinguin empfehlen?
„Und was kann ich für Sie tun?“, wollte Mommsen wissen.
Ich spreche mit einem Pinguin, dachte er entsetzt. War er verrückt geworden? Sollte er vielleicht doch einmal zum Arzt gehen, wie seine Mutter ihm geraten hatte. Sie fand, das geordnete, geregelte Leben ihres Sohnes, ohne Freunde und Bekannte, als nicht gesund. Mommsen hingegen war zufrieden. Er brauchte auf niemanden Rücksicht nehmen und konnte tun, was immer er wollte. War das der Preis dafür? Imaginäre Tiere, die mit ihm sprachen?
„Ich würde gern bei Ihnen baden“, riss ihn der Pinguin aus seinen Gedanken.
„Baden?“ Mommsen glaubte, sich verhört zu haben.
„Ja, baden“, wiederholte der Pinguin.
„Bei mir?“
„Ja, bei Ihnen.“ Der Pinguin wurde langsam ungeduldig. „Herr Mommsen“, seufzte er. „Wir kommen mit unserem Gespräch nicht wirklich voran, wenn Sie alles wiederholen, was ich sage.“
„Ich verstehe das aber nicht. Wie kommen Sie auf die Idee, bei mir baden zu wollen?“, fragte Mommsen und klang mutiger, als er sich fühlte. Waren Pinguine eigentlich gefährliche Tiere?
„Nun, wie Sie sicher bemerkt haben, regnet es seit Tagen. Der Schmutz der Straße hat mein Gefieder verklebt. Es muss gereinigt werden und deshalb möchte ich baden. Vielleicht könnten wir das Gespräch in Ihrer Wohnung fortsetzen?“ Der Pinguin schaute hoffnungsvoll zur Wohnungstür.
Mommsen zögerte noch immer. Er wollte den Vogel nicht in seine saubere Wohnung lassen, zumal der ja zugegeben hatte, schmutzig zu sein.
„Gut“, sagte Mommsen langsam, um Zeit zu gewinnen. „Das verstehe ich. Aber wieso gerade bei mir?“
„Nun, wie ich schon sagte. Sie wurden mir empfohlen. Man sagte mir, dass Sie in diesem Haus der Einzige mit einer Badewanne sind. Wissen Sie, wir Pinguine müssen nämlich baden. Duschen reicht nicht.“
Mommsen hasste jedwede Störung seiner Tagesroutine, aber plötzlich fühlte er einen Anflug von Abenteuerlust. Warum sollte er dem Pinguin nicht helfen und ihn baden lassen? Was hatte er schon zu verlieren? Vermutlich passierte das alles sowieso nur in seinem Kopf. Schließlich gab es keine sprechenden Tiere. Außerdem hatte er sonst nie Besuch. Nur seine Mutter kam einmal im Jahr, wenn er Geburtstag hatte.
Kurzentschlossen öffnete Mommsen die Tür und ließ den Pinguin herein.
„Das Badezimmer ist den Flur entlang, hinten rechts.“
Mommsen zögerte. Sollte er dem Pinguin Shampoo oder ein Handtuch anbieten? Er betrachtete den stämmigen und trotzdem stromlinienförmigen Körper des Vogels. Das rückseitige Gefieder schimmerte im matten Flurlicht in einem warmen ins Schwarze spielende Blaugrau. Der Bauch des Pinguins war wohl mal weiß gewesen, aber durch den Schmutz wirkte er jetzt dunkelbeige.
„Benötigen Sie noch etwas?“, erkundigte sich Mommsen.
„Nein, vielen Dank“, erwiderte der Pinguin. „Mir genügt sauberes Wasser vollkommen.“ Er watschelte in Richtung des Badezimmers und drückte mit seinen schmalen, kräftigen Flügelchen die Türklinke hinunter. Dann zögerte er kurz und drehte sich schließlich zu Mommsen um.
„Sie sind sehr freundlich zu mir. Das ist nicht selbstverständlich. Das Gefühl, bei Ihnen willkommen zu sein, ist sehr schön. Wenn Sie mögen, können wir Freunde werden.“
Mommsen überlegte kurz. „Es wäre mir eine Ehre“, sagte er schließlich. „Möchten Sie … ähm … möchtest du nach dem Bad vielleicht eine Kleinigkeit essen? Ich mache mir jeden Abend etwas, vor dem Fernsehen …“
„Falls du einen Fisch hast, würde ich sehr gern mit dir essen.“ Der Pinguin lächelte mit seinem langen, schlanken Schnabel und verschwand im Bad.
Während Mommsen einen Fisch aus dem Tiefkühlfach auftaute, dachte er, dass er etwas Besonderes sei. Wer kann schon von sich behaupten, einen Pinguin zum Freund zu haben?